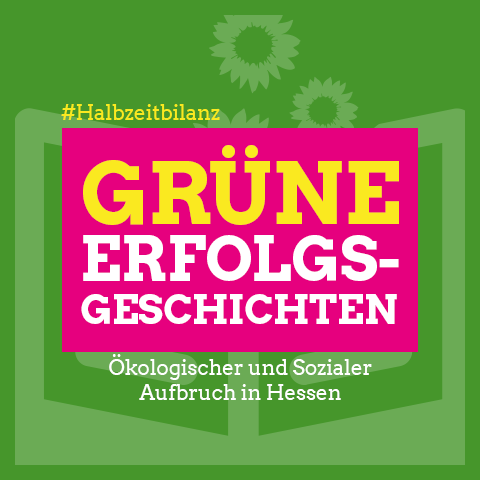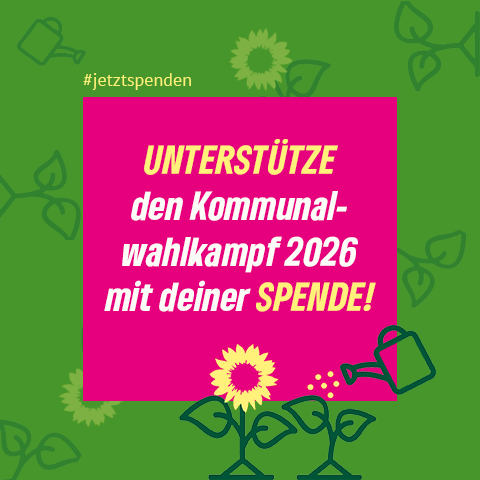Inhalt
Psychisch Erkrankten helfen, statt stigmatisieren
Die Behandlung psychischer Erkrankungen stellt in Hessen seit Jahren eine wachsende gesellschaftliche Herausforderung dar. Immer mehr Menschen sind betroffen, gleichzeitig bleibt der Zugang zu passender Unterstützung oft schwierig. Lange Wartezeiten, ein Mangel an Therapieplätzen und die ungleiche Versorgung in Stadt und Land führen dazu, dass viele Betroffene keine oder erst sehr spät Hilfe erhalten. Eine zusätzliche Hürde sind die nach wie vor bestehenden Vorurteile und Stigmatisierungen, die den offenen Umgang mit psychischer Gesundheit erschweren und Betroffene häufig davon abhalten, frühzeitig Hilfe zu suchen.
Im Rahmen des 7-Punkte-Plans fürs Bahnhofsviertel in Frankfurt plant die Landesregierung eine Änderung des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG), die eine Meldepflicht für psychiatrische Fachkliniken vorsieht. Diese sollen künftig verpflichtet werden, die örtlichen Ordnungs- und Polizeibehörden zu informieren, wenn „aus medizinischer Sicht die Sorge besteht, dass von der untergebrachten Person ohne weitere ärztliche Behandlung eine Fremdgefährdung ausgehen könnte“.
Diese Neuregelung stößt bei Expertinnen auf massive Kritik: Sie reaktiviert ein überkommenes Bild, das psychisch erkrankte Menschen pauschal als Sicherheitsrisiko darstellt, obwohl sie statistisch deutlich häufiger Opfer von Gewalt sind als Täterinnen. Psychisch erkrankte Menschen sind überdurchschnittlich oft von Polizeigewalt betroffen. In Krisen werden sie häufig als Bedrohung missverstanden, was zu tödlichen Eskalationen führen kann. Doch bessere Ausbildung und Sensibilisierung der Polizei im Umgang mit psychischen Erkrankungen fordert der Gesetzesentwurf nicht.
Statt Vorurteile abzubauen, zementiert die Landesregierung bestehende Stigmata weiter. Dies könnte dazu führen, dass sich Betroffene von psychischen Erkrankungen nicht trauen, sich dringend notwendige Hilfe zu suchen oder gegenüber medizinischem Fachpersonal wichtige Informationen zurückhalten, aus Sorge, dass ihre Daten an die Polizei gemeldet werden.
Die geplante Regelung vermittelt Misstrauen statt gesellschaftlicher Inklusion. Die Entlassung aus einer Behandlung, die eigentlich den Weg in Selbstständigkeit und Genesung markieren soll, wird so zu einem vermeintlichen Sicherheitsrisiko erklärt, das staatliche Überwachung erfordert. Damit verdreht die Landesregierung den Auftrag der ärztlichen Versorgung ins Gegenteil und gefährdet das Vertrauen zwischen Patient*innen und Behandelnden.
Diese geplante Änderung ist unverhältnismäßig, kontraproduktiv und verstärkt die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen. Schon die öffentliche Debatte über die Neuregelung hat zu großer Verunsicherung bei Betroffenen geführt. Statt auf Misstrauen und Kontrolle zu setzen, braucht es den Ausbau von Unterstützungs- und Versorgungsstrukturen, wie etwa mehr wohnortnahe, niedrigschwellige Beratungsstellen oder mobile Krisendienste mit aufsuchenden Hilfen, um psychisch erkrankten Menschen frühzeitig, niedrigschwellig und bedarfsgerecht Hilfe zu ermöglichen.
Der Parteirat möge deshalb beschließen:
- Die GRÜNEN Hessen lehnen die von der Landesregierung vorgeschlagene Änderung des §28 des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes in seiner derzeitigen Form entschieden ab.
- Die GRÜNEN Hessen setzen sich dafür ein, dass psychisch erkrankte Menschen Zugang zu niederschwelligen Anlaufstellen und psychosozialen Beratungsangeboten bekommen und dass Stigmata gegenüber Betroffenen in allen Bereichen der Gesellschaft abgebaut werden.